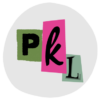Eine bedrückte Stille liegt über der Borker Straße in Lünen. Der Regen prasselt auf den Asphalt, Menschen stehen zusammen, manche halten Kerzen, andere schauen schweigend auf den Boden. Doch dort, wo sonst drei Stolpersteine glänzten, ist jetzt nur noch ein Loch im Pflaster.
Ein Diebstahl – aber warum?
In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar haben Unbekannte an der Borker Straße drei Stolpersteine ausgehoben und gestohlen. Warum? Das ist unklar. Die Polizei ermittelt, der Staatsschutz wurde eingeschaltet. Es wird vermutet, dass politische Motive dahinterstecken.
Lünen ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um rechte Aktivitäten geht. Rechte Sticker an Laternen, gesprühte Hakenkreuze, nun gestohlene Gedenksteine.
Ein Verbrechen ohne Profit – aber mit einer Botschaft
Stolpersteine bestehen aus Beton und einer kleinen Messingplatte. Kein wertvolles Material. Kein Diebstahl aus Geldnot. Die Tat erforderte Aufwand, Zeit – und eine Absicht.
„Wieso ist es dann passiert?“, fragt sich Udo Kath vom Arbeitskreis Lüner Stolpersteine. Auf Facebook teilen viele Menschen ihre Betroffenheit. Doch die zentrale Frage bleibt: Wer tut so etwas – und warum?
Eine Antwort gibt es nicht, aber eine Reaktion
Am 5. Februar, nur wenige Tage nach der Tat, versammeln sich Menschen an der Borker Straße. Sie lassen sich nicht einschüchtern. An der Stelle der gestohlenen Steine werden provisorische Ersatzblöcke mit Fotos der Namen der Opfer eingesetzt. Weiße Kerzen flackern im Wind.
„Wir dürfen nicht vergessen.“
Henriette Stiefel. Ihre Schwester Anna Schutz. Josef Stiefel. Das Ehepaar wurde im Ghetto Zamosc ermordet. Ihre Schwester starb im Konzentrationslager Theresienstadt. Ihre Namen sollten bleiben – doch jemand wollte sie aus dem Straßenbild reißen.
Andrea Ohm hat viele Stolpersteine verlegt. Sie ist Pfarrerin, Mitbegründerin des Lüner Arbeitskreises. 2009 legte sie die ersten beiden Steine in Lünen Süd. Seitdem kämpft sie gegen das Vergessen.
„Ich war in Magdeburg mit einer Frauengruppe und bin buchstäblich über einen Stolperstein gestolpert“, erzählt sie. „Das hat mich nicht mehr losgelassen.“ Sie suchte Sponsoren, organisierte Verlegungen, sprach mit Angehörigen. Heute sieht sie mit Sorge, wie Erinnerungsarbeit unter Druck gerät.
„Es ist erschreckend, wie viele Leute heute ignorant sind“, sagt sie. Besonders kritisch sieht sie die AfD: „Was für eine Geschichtsverdrehung da stattfindet, ist unfassbar.“
Geschichte als Waffe
„Man muss seine Geschichte kennen“, sagt Ohm. „Sonst landet vieles im Unbewussten, und man handelt nicht reflektiert.“ Doch genau das passiert. Fake News verbreiten sich schneller als Fakten. Ein einfacher Post, ein Video, ein Satz – und plötzlich glauben Menschen, Hitler sei Kommunist gewesen.
Leider wird Andrea Ohm in Zukunft nicht mehr in Lünen arbeiten, aber dank ihrer Arbeit gibt es in Lünen einen wichtigen Arbeitskreis mit engagierten Menschen wie Udo Kath, Michael Kupczyk, Siegfried Störmer, Wolfgang Balzer, Katrin Rieckermann, Gisela Sons, Dr. Katja Stromberg und Günter Blaszczyk.
„Damals fing es genauso an.“
Auch Rainer Schmeltzer, Mitglied des Landtags NRW, war bei der Gedenkveranstaltung anwesend. Seine Warnung ist deutlich: „Allein im letzten Jahr wurden über 4000 rechtsextreme Straftaten registriert. Damals fing es genauso an.“
Angriffe auf Gedenkstätten, Geschichtsverdrehung, Hass im Netz – die Zeichen sind da. Aber wohin führen sie?
Der Diebstahl der Stolpersteine ist mehr als eine Sachbeschädigung. Er ist ein Angriff auf die Erinnerung. Auf Menschen, die sich nicht mehr wehren können.
Rechtsextremismus beginnt leise. Mit Lügen, mit Relativierungen, mit kleinen Taten. Doch er darf nicht leise bleiben.
Erinnerung ist eine Verantwortung, die wir alle tragen. Die Menschen, an die diese Steine erinnerten, können sich nicht mehr verteidigen. Aber wir können es.